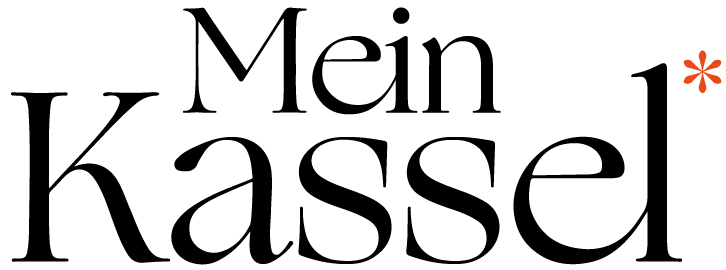Dass sich Eva Renée Nele Bode den Künstlernamen E. R. Nele zugelegt hat, unter dem sie als Bildhauerin, Grafikerin und Designerin bekannt geworden ist, hängt mit ihrem Vater Arnold Bode zusammen. „Das haben er und ich so beschlossen“, sagt sie. Den weltbekannten Namen des umtriebigen documenta-Begründers zu tragen, sei nämlich nicht immer einfach gewesen, sondern für die künstlerische Entwicklung der Tochter „durchaus belastend“. Eifersucht und Voreingenommenheit wollte E. R. Nele aus dem Weg gehen, indem sie den Namen Bode ablegte. Unabhängig davon habe sie ihren Vater geliebt, verehrt und mit ihm viel zusammengearbeitet. Geht es um das Erbe Bodes, das in Kassel gehütet und gepflegt wird, ist E. R. Nele, die 1932 in Berlin geboren wurde, zu jedem Anlass vor Ort, sei es zur Verleihung des Arnold-Bode-Preises oder zur Vorstellung der neuen documenta-Leiterin Naomi Beckwith.
Das kriegszerstörte Kassel verließ sie früh, um in Berlin, London und Paris zu studieren und sich ausbilden zu lassen. Ihren Weg als Künstlerin ging sie erfolgreich allein: Sie war Teilnehmerin der documenta II (1959) und d III (1964) und man fand und findet sie mit ihrem Werk in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten. Ihre Skulpturen sind in Museen wie der Neuen Pinakothek in München, in renommierten Privatsammlungen und im öffentlichen Raum zu finden. Zu ihren Arbeiten zählen sowohl monumentale Stahlplastiken als auch filigran gefertigte Schmuckstücke, die im Victoria and Albert Museum in London sowie in der Neuen Galerie in Kassel zu finden sind.
Eine ihrer wichtigsten Arbeiten ist die Installation „Die Rampe“, die sich auf dem Gelände der Universität Kassel befindet. Die Arbeit, ein Reichsbahn-Güterwaggon, aus dem über eine Rampe Gestalten in Form von leeren Mantelhüllen aus Metall treten, ist ein Denkmal für die Deportierten und andere Opfer des NS-Regimes.
Nach dem Studium war E. R. Nele mit ihrem Mann, dem Theaterregisseur und Vater ihrer beiden Söhne, Klaus Riehle, nach Zürich gezogen und im Anschluss nach Frankfurt, wo Riehle ein Engagement am Schauspiel Frankfurt antrat. Seit 1965 lebt und arbeitet E. R. Nele in Frankfurt.
Wer heute ihr einladendes, lichtdurchflutetes Haus betritt, bekommt einen Eindruck von einer ihrer weiteren schöpferischen Facetten: als Möbeldesignerin. Vom massiven Tisch mit Metallunterbau bis zur filigranen Lampe ist E. R. Nele umgeben von selbst entworfenen und gebauten Möbeln.
Noch immer findet man die zierliche 93-Jährige mit dem leuchtend roten Haar regelmäßig in einem ihrer beiden Ateliers an. Im Atelier im Wohnhaus sind zurzeit Ordner mit Papieren und Fotos ausgebreitet. Nele verfasst ihre Memoiren. Und die dürften sich wie ein Jahrhundertroman lesen, denn sie ist eine Zeitzeugin, die die große Kunst des 20. Und 21. Jahrhunderts hautnah erlebte und mitgemischt hat. Wenn sie von ihren Freunden, Lehrern und Weggefährten erzählt, tauchen Namen auf, die Kulturgeschichte geschrieben haben, wie Henry Moore, Elias Canetti oder Erich Fried.
Manchmal staunt sie selbst, dass sie mittendrin war. So wie sie perplex war, als sie einmal zur Biennale in Venedig auf einer Party der berühmten Kunstsammlerin und -mäzenin Peggy Guggenheim (1898–1979) auf deren Kaminsims überraschend eine ihrer eigenen Skulpturen entdeckte.
Mein Kassel hat eine gut gelaunte, gastfreundliche E. R. Nele in Frankfurt-Sachsenhausen besucht und mit ihr ein spannendes Gespräch über Kunst des 20. Und 21. Jahrhunderts, über die documenta einst und jetzt, über ihren Vater Arnold Bode und vieles mehr geführt.
MEIN KASSEL: Liebe Nele, mit Dir ein Gespräch zu führen, ist kein leichtes Unterfangen, denn es gibt so viele Themen, die man mit Dir gerne besprechen möchte.
E. R. Nele: Ja, so ist das, wenn man so ein langes Leben hat wie ich.
Du bist die Tochter von Arnold Bode, dem Begründer der documenta. Wie ist das für Dich, mit diesem Erbe zu leben? Du hattest einen Bruder, der inzwischen verstorben ist. Also, Du bist jetzt praktisch als Tochter …
… die Überlebende …
… und nimmst das Thema documenta sehr ernst. Wenn es Veranstaltungen gibt, dann bist Du vor Ort in Kassel, obwohl Du in Frankfurt wohnst. Was bedeutet es Dir, documenta-Repräsentantin zu sein?
Na ja, ich bin ja quasi mit der documenta aufgewachsen, mit allen Vorbereitungen und mit den Geschichten, die damit zusammenhängen. Und da gibt es viele Geschichten.
Gerade bist Du dabei, Deine Memoiren zu verfassen. Werden wir da diese Geschichten lesen?
Ich hoffe es.
Du bist ja nicht nur Bode-Tochter, sondern selbst Künstlerin und hast auch an zwei documenta-Ausstellungen teilgenommen. Wie erinnerst Du Dich daran?
Weil ich in England studiert habe, war ich befreundet mit englischen Künstlern. Vor der zweiten documenta kam mein Vater mich in London besuchen. Da habe ich ihm meine Freunde vorgestellt. Dazu gehörte auch der Bildhauer Henry Moore. Der wollte mich gerne als Assistentin anstellen, aber da habe ich mir gedacht: Noch ein Übervater, das wäre zu viel, und ich sagte ab. Aber wir waren dann befreundet, und als ich meinem Vater Henry Moore vorstellte, haben die sich sofort gut verstanden. Dazu kamen dann Reg Butler, Lynn Chadwick und andere, die er über mich kennenlernte und die er zur documenta einlud.
Und Du hast vermittelt?
(lacht) Ja, weil er kein Englisch sprach.
Aber Du warst ja selbst documenta-Teilnehmerin.
Das hat mich auch verwundert. Und einige waren darüber sogar verärgert, weil ich ja die Tochter war. Aber ich konnte nichts dafür. Auch mein Vater hatte darauf keinen Einfluss. Das Gremium, das über die documenta-Teilnehmer entschied, hat ihn rausgeschickt, als sie über mich berieten. Die haben dann über mich gesagt: Die macht großartige Grafik, stellt da und da aus, wir wollen die auf der documenta sehen.
Du bist 93 Jahre alt und arbeitest immer noch als aktive Künstlerin in zwei Ateliers, einem in der Stadt und einem in Deinem Haus. Woher holst Du die Energie?
Ich habe natürlich auch Hilfen. Seit 40 Jahren arbeite ich mit einer Firma zusammen, mit der ich alle meine großen Objekte realisiere, auch die zwei Meter hohen Schmetterlinge, die ich im vergangenen Jahr für den Frankfurter Palmengarten angefertigt habe. Meine Arbeit für den Künstlerfriedhof in Kassel habe ich ebenfalls mit denen gemacht.
Du sprichst von Deiner Arbeit aus dem Jahr 2022 für die Künstlernekropole.
Sie heißt „Der Gang“ und bedeutet: Ich gehe von diesem Leben in ein anderes oder ein nicht-anderes. Es ist jedenfalls der letzte Gang.
Auf mich wirkt das Kunstwerk mit der balancierenden Figur fast heiter, auf jeden Fall entspannt.
Ja, ich bin auch total relaxed, obwohl der Tod sozusagen vor der Tür steht
Kassel ist Deine Heimatstadt und am Ende kommst Du mit dem von Dir gestalteten Grabmal wieder nach Kassel zurück. Du hast die Stadt erlebt, obwohl Du sie als junge Frau bereits verlassen hast. Woran erinnerst Du Dich?
Als kleines Kind habe ich die Stadt am Rande wahrgenommen. Da ging es einfach nur ums Fahrradfahren auf der Gass. Da ist keine Stadterinnerung. Aber nach dem Krieg, als ich mit meiner Mutter das erste Mal wieder in Kassel war, empfand ich nur Grauen. Da ragten riesige Hausruinen in den Himmel und ich dachte: Die kippen gleich um. Der Anblick des zerstörten Kassel war schrecklich. Ich war ja im Krieg zeitweise bei meiner Tante im Elsass untergebracht. Und als ich zurückkam, war unser Haus vom Erdboden verschwunden. Zum Glück hat meine Mutter überlebt.
Nun waren das Kriegserlebnis, der Naziterror und das, was im Dritten Reich mit der Kunst passiert ist, Triebfedern für Deinen Vater, die documenta aus der Taufe zu heben.
Mein Vater hatte schon Ende der 20er-Jahre moderne Ausstellungen in Kassel gemacht und war mit seinem Bruder bis nach Weimar geflogen, um dort im Bauhaus Paul Klee und Wassily Kandinsky zu treffen. Er war schon immer am Ausstellungsmachen sehr interessiert. Er wusste, dass es wichtig war, vor allem in der Provinz – Kassel war damals Provinz – über die neue Kunst aufzuklären und sie zu dokumentieren.
Aber es war ja auch ein politisches Statement von ihm zu sagen: Wir stellen jetzt Künstler aus, die in den letzten Jahren verboten waren.
Das war sein Hauptanliegen. Er war für eine kurze Zeit in einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager zusammen, mit vielen jungen Männern. Da stellte er fest, dass die keine Ahnung von Kunst hatten. Die sind in einer Null-Landschaft in Bezug auf Kunst groß geworden. Und so hat mein Vater bald nach dem Krieg den Entschluss gefasst: Wir müssen zeigen, was es gab, bevor dieser Hitler kam. Es gelang ihm, den US-amerikanischen Kulturoffizier George Aldor zu überzeugen. Der fand meinen Vater und seine Idee von einer internationalen Kunstausstellung faszinierend und sagte: Das unterstützen wir, dafür muss es Geld geben.
Dein Vater war ein Ausbund an Ideen, an Kreativität und Tatkraft …
Er war ein Nach-vorne-Denker. Und das permanent.
Sein Credo lautete: Kunst darf nicht verboten werden.
Und jetzt kommen die jungen, wunderbar schlauen Leute, die Kunst studieren, und sagen, mein Vater hätte zu wenig jüdische Künstlerinnen und Künstler in der ersten documenta gezeigt. Die wissen nicht, wie das damals aussah. Im Fridericianum war der Boden aufgerissen, da wurden schon die Klees gehängt. Wenn diese Leute wüssten, wie prekär das war. Heute wird alles Mögliche in die documenta reininterpretiert. Dabei war die Absicht meines Vaters nur die Aufklärung und die Werke der zur Nazizeit verbotenen Künstler zu zeigen.
Du hast dann Kassel verlassen, um zu studieren. Du wolltest mehr sehen als nur Kassel, Nordhessen und Deutschland.
Ich war erst in Köln und dann in Krefeld, das waren auch sehr zerstörte Städte. Dann kam ich in den Semesterferien nach Kassel und bei meinen Eltern war Annely Juda, die berühmte Londoner Galeristin, eine Kasseler Jugendfreundin meines Vaters, zu Besuch. Sie fragte mich: Warum studierst du nicht in London? Und ich dachte: Das ist die Idee des Tages. Ich bekam ein Stipendium und irgendwann haben mich meine Eltern nach Holland gebracht und ich bin mit dem Schiff alleine nach London gefahren. Ich studierte an der Central School of Arts and Crafts, die heißt jetzt Central St. Martins. Das war eine tolle Schule. Sehr streng. Man musste immer pünktlich morgens um 9 Uhr da sein.
Du warst ja von Anfang an auf mehreren Ebenen aktiv: als freie Künstlerin einerseits, aber Du hast auch als Handwerkerin gearbeitet und Auftragskunst gemacht.
Ich habe meine Skulpturen oft bezahlt mit dem Verkauf meiner Schmuckkreationen. Die waren einfacher zu verkaufen als eine Skulptur. Ich habe auch als Möbeldesignerin gearbeitet, habe 20 Jahre lang für eine Lampenfabrik das Design gemacht. Das sind so Parallelaktionen. Die ersten Schritte im Handwerk habe ich mit meinem Vater unternommen. Ich habe mit ihm Tapeten gestaltet, Muster für Stoffe entworfen und so weiter.
Hinter Dir steht ein neues Kunstwerk, das Dir wichtig ist. Darauf steht zu lesen: „No war“.
Ich beschäftige mich immer wieder mit Politik und den Problemen, die mich umgeben und bedrücken. Ich drücke das in vielen meiner Grafiken aus. Auf dieser, einer meiner letzten Arbeiten, steht einfach nur „No War“. Krieg bedeutet, dass unwahrscheinlich viele Menschen bewegt werden, um getötet zu werden. Die Vorstellung ist so grauenhaft. Ich bin mein Leben lang davon begleitet worden, weil es immer irgendwo grässliche Kriege gab und gibt. In Deutschland und in Europa sind wir im Moment in einer besonders gefährlichen Phase: Wir werden bedroht von Monstern.
Politisch ist auch „Die Rampe“, ein bedeutendes Kunstwerk für Dich, aber auch für Kassel. Wie ist es entstanden?
Schon in den 70er-Jahren habe ich mit dem Bild der Mäntel gearbeitet, in denen der Mensch als Individuum unsichtbar ist. Da habe ich eine Ausstellung nur mit den Mänteln gehabt. Die Mäntel auf der Rampe in Kassel stellen Figuren ohne Gesichter dar, übertragbar auf alle Menschen, die im Nazi-Regime gefoltert und getötet wurden. So viele. Die Individualität ist verschwunden, symbolisch eint sie die qualvoll gedrückte Haltung, die Verzweiflung. Darin zeichnet sich das ganze Drama ab.
Wer hat sie in Auftrag gegeben?
Es gab keinen Auftrag. Das war eine Ausstellung, die parallel zur documenta lief. Die hieß Stoffwechsel. Und da habe ich, als ich die Einladung bekam, sofort angerufen und gesagt: Geht doch mal raus und guckt vor Eurer Tür. Auf dem ehemaligen Henschel-Gelände, wo sich jetzt die Uni befindet, da ist eine Schiene, und in Waggons sind auf dieser Schiene aus Russland die Gefangenen gekommen, die Zwangsarbeiter. Die Menschen sind also direkt auf das Henschel-Gelände transportiert worden. Ich kann mich noch erinnern, wie sie später zu Fuß am Grundstück meiner Großeltern vorbeigingen, auf den Hegelsberg, wo ihr Lager war. Das habe ich als Kind beobachtet. Das hat sich im Kopf festgesetzt. Ich habe dann einen Waggon bei der Bahn gemietet, für damals 2000 Mark, die ich gar nicht hatte, die ich mir leihen musste, und dann kam dieser Waggon auf eben dieser Schiene vorgefahren. Da habe ich meine Figuren reingestellt. Die Holzrampe hat die Firma meiner Großeltern gebaut. Und dann geschah das Drama, dass nur Tage nach der Ausstellungseröffnung Neonazis aus der Gegend eingebrochen sind und Feuer gelegt haben. An die Innenwand des Waggons haben sie mit Kreide geschrieben „Wir kommen wieder“. Und das haben wir jetzt mit der AfD.
Das Kunstwerk wurde damals zerstört?
Ja. Die Figuren wurden geklaut. Jedenfalls sind sie verschwunden. Dann habe ich alles neu gebaut. Auf Betreiben von Professor Dietfrid Krause-Vilmar wurde an der Uni Kassel Geld gesammelt, und damit konnten die neuen Figuren finanziert und in Bronze gegossen werden.
Jetzt gibt es einen neuen Standort.
Das war notwendig geworden, weil am ersten Standort weitere Gebäude für die Universität gebaut wurden. Dann musste im neuen Ambiente der Außenanlage ein Platz gefunden werden. Für mich ist vor allem wichtig, dass sich das Kunstwerk in der Nähe der Studenten befindet, sodass es für die jungen Leute immer wieder einen Anlass bietet, um zu diskutieren und über das, was geschehen ist, ins Gespräch zu kommen.