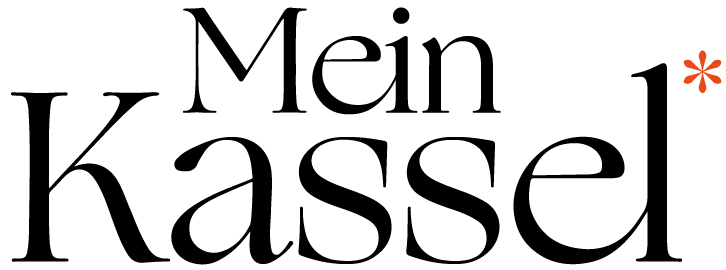Nach der documenta ist vor der documenta – und zwischen den Ausstellungen hat Kassel kulturell ziemlich viel zu bieten. Dafür sorgen auch viele einzelne Künstler, deren Projekte weit über die Grenzen der Stadt hinaus Strahlkraft haben. In einem Fall sogar bis nach Hollywood – aber man muss ja nicht immer einen Oscar für seine Projekte oder seine Kunst bekommen. Man kann auch so richtig gut sein. Lesen Sie selbst …
Sven Wolf & Sun Yong Han

Das Restaurant Voit in der Friedrich-Ebert-Straße ist seit 2014 eine feste Adresse in Kassel für Freunde der Spitzenküche. Inhaber Sven Wolf und sein internationales Team erkochten sich von 2018 bis 2020 einen Michelin-Stern – aktuell gibt es zwar keinen Stern mehr, aber der Restaurantführer Gault Millau verlieh zwei rote Kochmützen. In Österreich würde man ihn deshalb einen Haubenkoch nennen – was aber irgendwie nicht nach Kompliment klingt. Außerdem wäre es nur die halbe Wahrheit, denn seit 2021 hat der Südkoreaner Sun Yong Han in der Küche das Sagen – Sven Wolf bleibt Inhaber und kümmert sich um die Weine. Sun ist in der Küche Chef eines internationalen Teams, das auch aus Mexiko und Südafrika stammt. Eine Folge: Die Umgangssprache in der offenen, von den Gästen einsehbaren Küche ist Englisch. Eigentlich hat Sven Wolf (Jahrgang 1981) noch viele kreative Berufsjahre als Küchenchef vor sich. Die Pandemie hat ihm, der vorher in seinem Betrieb alles gemacht hat, verdeutlicht, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Diese Erkenntnis ist aber auch ein Resultat des Einstiegs von Sun, der im Juni vergangenen Jahres kam. Die beiden arbeiteten eine Zeitlang nebeneinander. Der Südkoreaner, der sieben Jahre insgesamt im Drei-Sterne-Restaurant „La Vie“ in Osnabrück gearbeitet hat und außerdem auch im „Lakeside“ in Hamburg und in Frankreich Gourmet-Input bekam, überzeugte Wolf aber sehr schnell von seinen Qualitäten. „Da machte es keinen Sinn, dass wir nebeneinander arbeiteten,“ sagt Wolf. Nun also die neue Aufgabenteilung. Das neue kulinarische Angebot kommt bei den Gästen bestens an, in documenta-Zeiten ist die Kundschaft zudem internationaler als sonst. Hat die Küche eine bestimmte Ausrichtung? „Wir nageln uns auf nichts fest,“ sagt Sven Wolf. Ziel ist: Abwechslung für den Gast, dass manches Angebot Impulse aus den Heimatländern der Team-Mitglieder hat – logisch. Ein neues Kapitel hat für das „Voit“ also begonnen. Erleben kann man das dienstags bis
samstags ab 18 Uhr.
Thomas Stellmach

Die Nachricht aus Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, war kurz, knapp, präzise. Und erfreulich. Thomas Stellmachs neuester Film „The Sausage Run“ hatte beim Filmfestival den Hauptpreis erhalten. Nicht, dass der Kasseler Animations-Filmkünstler nicht schon den einen oder anderen Erfolg zu verbuchen gehabt hätte. 25 Jahre ist es her, da erhielt er einen Oscar für seinen Film „Quest“. Aber er bedient mit seiner Arbeit ein Genre, in dem man schon genau schauen muss, dass sich die monate-, manchmal jahrelange Arbeit an einem neuen Projekt auch lohnt. Da ist es besonders schade, dass es sich bei den Preisen meist um solche ohne Preisgelder handelt. Thomas Stellmach (Jahrgang 1965) macht seit 40 Jahren Trickfilme. „Domino Play“ hieß der Streifen, den er damals mit 17 Jahren in der Heimat in Straubing produzierte. Nein, sagt er, vergleichbar mit herkömmlichen Filmen sei die Produktion eines solchen Animationsfilmes nicht. Trickfilme entstünden wie ein Puzzle: Viele kleine Schritte, in denen der Streifen von groben Bildern, einem genauso groben Ablauf, erster Musik und ersten Geräuschen hin zum Ende entwickelt wird. Stellmach ist ein One-man-team – zumindest die meiste Zeit zwischen den Projekten. Aber auch er braucht Spezialisten, die als Freelancer ihre Fähigkeiten einbringen. Ist der Film fertig, ist Stellmach dann für die Vermarktung wieder allein zuständig. Und muss sehen, dass parallel eventuell schon ein neues Projekt zumindest weitgehend finanziert ist. Da muss man schon Trickfilmer aus Leidenschaft mit Hang zur Selbstausbeutung sein. Acht Jahre war das mal anders. Da machte er mit zwei Partnern Werbung, erfolgreich, auch für Big-shots in der Branche wie Wrigley’s oder auch fürs ZDF. Trickfilm spricht eine eher kleinere Zielgruppe an. Was dazu führt, dass Stellmach, was seine Tätigkeit als Künstler betrifft, in Kassel für viele eher unter dem Radar fliegt. Er selbst will dies ändern – indem er beispielsweise im November im Theaterstübchen seine Filme zeigt – und wie sie entstehen, welche harte, detailtrockene Arbeit hinter ein paar Minuten Animation stecken. Die Termine: 21., 28. und 30. November. Da wird er auch erzählen von „The Sausage Run“. Um was es geht: Es handelt sich um eine Variation des Märchens „Rotkäppchen“. In dieser Fassung ist Rotkäppchen ein Lamm, der böse Wolf ist ein Metzger und der Jäger ist ein Hund – die Rollen der Tiere und der Menschen sind vertauscht. Denn das kommt ja noch hinzu: Stellmach ist nicht nur Filmemacher.
Er ist auch Autor.
Klaus Stern

Es gibt eine ganz besondere Szene im Dokumentarfilm „Die Autobahn – Kampf um die A49“, da ist die Stille im Kinosaal so spannungsgeladen, dass es knistern könnte. Im Dannenröder Forst interviewt eine FFH-Reporterin die Sprecherin jener Aktivistengruppe, die in dem Gelände in Zelten, in Baumhäusern wohnt und versucht, die Rodung der Bäume zu verhindern. Mit Blick auf einen bevorstehenden Polizeieinsatz fragt die Reporterin, was die Aktivistin denn dazu sagen würde, wenn Steine auf Polizisten flögen. Die Antwort: Ausweichend. Die Frage wird wiederholt. Die Antwort: Ausweichend. Die Reporterin hakt, journalistisch vorbildlich, nach. Die Kamera zeigt die Aktivistin. Die ringt sekundenlang nach Worten. Sagt nix, verkrampft fast, findet keine Antwort. Die Stille – vielsagend, ergreifend, irgendwie gar erschütternd. Klaus Sterns neuer Film, der im Mai in die Kinos kam, ist – um ein Fazit vorwegzunehmen – ein neuer Maßstab für politische Dokumentarfilme. Brillant die Bestandsaufnahme, 86 Minuten beeindruckendes Filmemachen. Und wenn man sich als Zuschauer fragt: Wie haben die denn diese Szenen bloß alle drehen können? Dann weiß der Filmemacher selbst: Irgendwie alles richtig gemacht. Klaus Stern (Jahrgang 1968) ist gebürtiger Schwälmer, „sein“ Dorf Wiera wird künftig ein Ort am Rande der Autobahn sein. Dass er mit seiner Familie selbst mittelbar vom Bau der Autobahn betroffen ist, dass er selbst eine klare Position zum Ausbau hat („Nein!“) – man merkt es dem Film nicht an. Die Bilder, die Personen sprechen. Alles und jeder für sich. Keine Position bleibt ungehört. Alles authentisch. Wie in früheren Filmen. Der im Vorderen Westen lebende Filmemacher hat in manchen seiner Streifen Ereignissen, Geschichten und Personen verewigt. Und sich nicht nur Freunde gemacht. Etwas, womit er leben kann. Und wovon er leben kann, denn die Filmemacherei ist ein Fulltime-Job für den Mann, der selbst keine Kamera führt und auch nicht schneiden kann. Sein Team – das besteht aus einem festen Stamm, Michael Kadelbach, der die Musik beisteuert, ist gar seit 20 Jahren dabei. Und Editorin Friederike Anders schneidet seine Filme seit 2003 – sie hat, sagt er, einen großen Anteil daran, dass die Filme so sind, wie sie sind. Ein eingespieltes Team – da kann Stern dann selbst auch mal bei den Drehs nicht dabei sein. Co-Regisseur Frank Pfeiffer war gelegentlich allein vor Ort. Und lieferte auch Bilder aus schwindelerregender Höhe aus den Baumhäusern. Die besondere Kunst von Stern und seinem Team ist, wie schon in den Filmen zuvor, so nah an die Beteiligten heranzukommen. Nicht ganz einfach bei Menschen, die sich nur komplett vermummt äußern. Klaus Stern weiß, dass er sich selbst gut vermarkten kann – und so ist das Ganze ein erfolgreicher Ein-Mann-Filmbetrieb. Produktion, Verleih, Regie, Drehbuch – alles unter einem Dach. Wobei Frank Pfeiffer auch beim Drehbuch beteiligt war. Aber wie viel Drehbuch ist bei einem solchen Produkt überhaupt machbar? Eineinhalb Seiten waren es, sagt Stern, als er sich im Vorfeld um die Finanzierung kümmerte und im WDR einen Partner fand. Nach dem Film ist vor dem Film – und so entsteht im Geiste bereits das nächste Projekt. Ohne thematische Anbindung an die Region Nordhessen. Es geht um eine Firma im Silicon Valley. Das Projekt ist durchfinanziert, die Basis ist geschaffen. Das einzige Problem: „Der Protagonist ist noch nicht auf meiner Seite.“ Was nicht ganz unwichtig ist, denn der Film soll im Juni 2023 fertig sein. Also immer mal durchatmen zwischendurch, Kopf freikriegen. Klaus Stern gelingt das am besten im Tor bei Dynamo Windrad. Mittlerweile bei den Alten Herren, aber beim ersten Spiel des Vereins 1991, da war er in der Ersten die Nummer eins, da hielt er seinen Kasten fast sauber. Gegen Hertingshausen ging es, Dynamo siegte 3:1. Neun Jahre später, im Jahr 2000, da reifte langsam die Idee zum Film über die A49. Der jetzt zu sehen ist …
Bene Schuba

Wenn man den Begriff „Schuba“ googelt, steht bei den Ergebnissen an erster Stelle ein russischer Schichtsalat mit Heringen und Roter Bete. „Ich glaube nicht, dass ich da mal vor stehe.“ Aber wenn sein Modestyle so heißen würde wie er selbst, dann würde es Bene Schuba locker schaffen. Jackett, Hemd, stets Krawatte, Krawattenspange, gegeltes Haar, ungewöhnliche Brille. Bene ist eine Erscheinung. Vermutlich jeder hat ihn schon mal in der Stadt gesehen. Weil er eben auffällt. Die Klamotten sind aus Second-Hand-Läden. Den des DRK am Stern beispielsweise nutzt er vor allem für seine Krawatten und Hemden. Das ist der erste Schuba-Tipp. Der zweite: Wer was gegen müffelnde Sachen aus dem Second-Hand-Shop tun will, sollte die Kleidungsstücke in eine Plastiktüte packen, in die Gefriertruhe legen, einmal einfrieren lassen, auftauen. Schon riechen sie besser. Dass Bene Schuba, in Hameln geboren, in Hessisch Oldendorf aufgewachsen und zum – mittlerweile abgebrochenen – Lehramtsstudium nach Kassel gekommen, Ideen hat, beweist er mit seiner Kunst. Er ist Musiker, spielt Schlagzeug seit seinem fünften Lebensjahr („Da gibt es ein Foto aus der Zeit: Da trage ich auch schon Krawatte.“), Zweitinstrument Klavier. Damals wurde er noch mit seinem vollen Vornamen angesprochen: Benedikt. Das „Bene“ kam irgendwann als Jugendlicher. Und er mag den Namen. Auch, weil er „nicht so ne starke Geschlechteridentität hat“. Bene ist jetzt 31. Der Musikbunker in der Friedrich-Engels-Straße ist sein zweites Zuhause. Hier trifft er Menschen, mit denen er Musik macht, kann sich mit Seinesgleichen austauschen, mal über seine eigenen Projekte reden. Und von denen gibt es reichlich. In diversifizierender Art, eben nicht nur Musik. Geschauspielert hat er schon im Staatstheater, im Augenblick ist er in der Szene für zeitgenössischen Tanz unterwegs. Und ist im Alltag neugierig. Beispielsweise auf Töne. Arbeitet derzeit mit Baustellen-Flatterband – was kann man musikalisch damit erzeugen? Entwickelt eine Performance mit Steffen Modrow – da geht es dann um Klänge, die auf Keramikstücken der Künstlerin Ulrike Seilacher erzeugt werden. Aus seiner Sicht fühlt sich das Leben gut an. Auch weil Kassel passt. Vielleicht nicht für immer, wenn es irgendwann mal zu leicht und zu gewohnt ist, müsse man über Neues nachdenken. Kann man von seiner Kunst, der Musik, den anderen Dingen leben? „Ja“, sagt er. Man müsse allerdings hart dafür arbeiten. Seine Eltern, beide (nicht professionelle) Musiker, sind mittlerweile beruhigt, dass der Lebensweg des Filius ungewöhnlich, aber belastbar ist. So ein Leben geht allerdings auch nur, wenn man keine Neigung zu Existenzängsten hat. Bene Schuba hat davor keine Angst. Und geht sogar noch weiter: „Ich habe überhaupt keine Angst.“ Und erzeugt mit der Perlenschnur, mit der das Rollo bedient wird, im Café gleich mal ein paar neue Klänge. Mal sehen, wann es als Instrument dient.